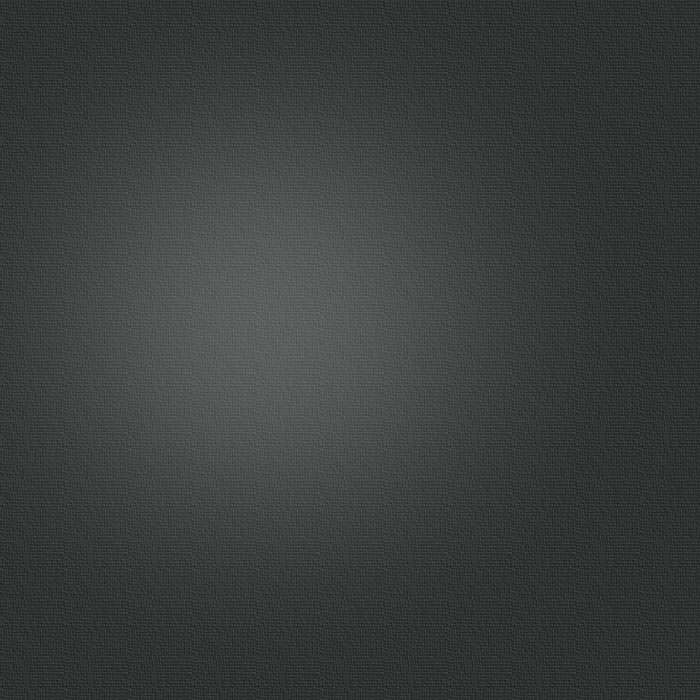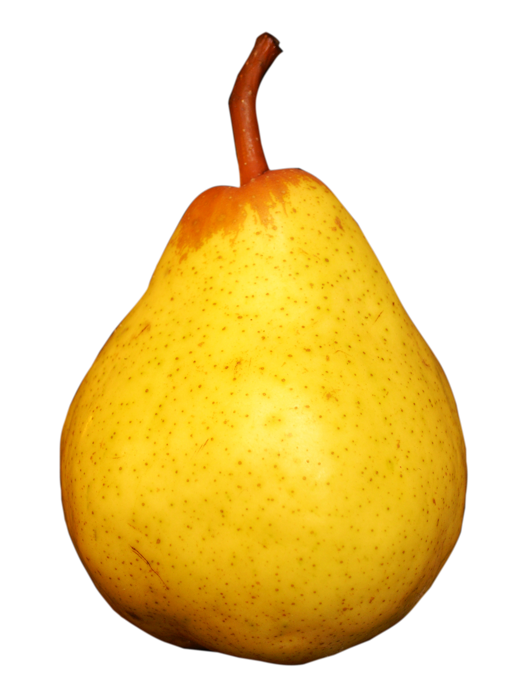Birnen sind nicht wie Äpfel. Das ist doch mal ein erster Satz, mit dem sich Preise gewinnen lassen. Im Ernst: Birnen sind schwierig. Man muss zur Erklärung gar nicht die öde Mann-Frau-Dialektik bemühen. Birnbäume kränkeln gern. In den mit
Wacholder - dem Winterwirt des Erregers - durchseuchten Berliner Gärten sitzt jedem von ihnen der
Gitterrost auf den Blättern.
Der Schorf fällt auch gern mal über die Bäume her. Weil Birnen zudem früher blühen als Äpfel, kriegen sie mehr Frost ab. Außerhalb des Intensiv-Obstbaus tragen die Bäume aufgrund all dieser Widrigkeiten nur alle drei, vier Jahre ernst zu nehmende Mengen an Früchten. Meist gibt es dann auch nur ein sehr kleines Zeitfenster, in dem die Birnen vollreif sind und den perfekten Geschmack entwickeln. Kurz zuvor sind sie grün, hart, trocken und kaum aromatisch, kurz danach sind sie braun, ohne Biss, mehlig und duften nach Aceton.
Wer, wie wir jetzt, mit einem Mal eine größere Ladung baumreifer Birnen bekommt, muss täglich unerhört viele von ihnen essen und sich zugleich ein paar Verwendungsmöglichkeiten ausdenken. Dabei ist die Saison noch längst nicht vorbei - zwar versiegt gerade die Quelle für die gelben Williams-Christ-Birnen aus dem elterlichen Garten, doch hier im Hof stehen vier weitere gut bestückte Bäume. Welcher Sorte sie zugehören, kann ich nicht sagen - es gibt glänzend grüne in musterhafter Birnengestalt, dunkelgelbe mit rauer Schale und sehr variabler Form sowie bräunlich grüne mit ebenfalls matter Haut. Erstaunlicherweise trägt selbst der traurigste Baum auf der Wiese, von dem nur mehr ein Stumpf mit zwei, drei Ästen übrig ist, einige kleine, helle Früchte. Wohin mit all dem?
Man kann natürlich aus Birnen einen eben so schönen Strudel machen wie aus Äpfeln (näheres
hier schon beschrieben). Sie sollten allerdings
etwas fester und noch nicht vollreif sein, sonst sinkt die Teigrolle zusammen und wird zu nass. Eine Tarte mit karamellisierten Birnen hat ebenfalls großen Charme (Rezept
hier, noch nicht ausprobiert). Im Gegensatz zu Äpfeln finden Birnen aber beim Kochen von Konfitüre oder Gelee deutlich weniger Beachtung - höchstens mal in seltsamen Kombinationen, etwa mit Erdbeeren. Ich fand das schon immer rätselhaft und ungerecht. Birnenmarmelade geliere so schlecht, hieß es hin und wieder schulterzuckend. Niemand, den ich kannte, machte sich die Mühe.
Dennoch - was liegt eigentlich näher als ein Gelee aus Birnensaft, wenn es das gleiche auch vom Apfel gibt? Ausprobieren. Die Schrittfolge ist die nämliche wie beim Apfelgelee (
hier), nur ist besonders darauf zu achten, dass der Anteil Gelierzucker genügend hoch ist. Auf 750 ml Birnensaft kommt 1 kg Gelierzucker 1:1. Ein paar Tropfen Zitronensaft befördern den Prozess der Erstarrung - nur nicht zu viel, sonst überdeckt die grobe Säure der Zitrone das schüchterne Aroma der Birne. Statt mit Vanille wie bei der Apfel-Variante habe ich beim Birnengelee mit einer halben Stange Zimt gearbeitet -
beim nächsten Mal bin ich vielleicht mutiger und nehme die doppelte Menge. Der Saft wurde tatsächlich zu einem vorbildlich festen Gelee, nichts da von mangelnder Standhaftigkeit. Und der Stoff schmeckt zudem nachdrücklich nach Williams Christ. Weich und rund vorbildlich birnenhaft. Der Gerechtigkeit ist hiermit Genüge getan.