Wie man Fernsehen macht
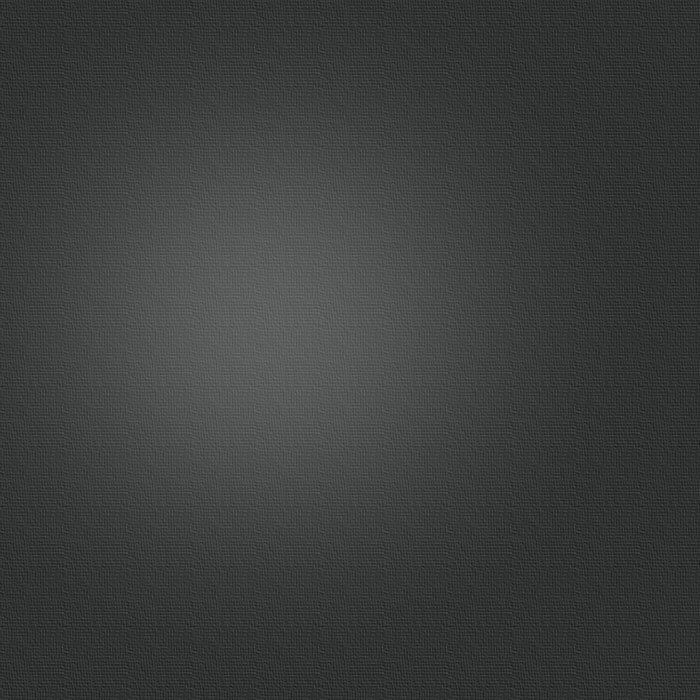

Freitag, 26. März 2010

Suchen Sie nicht bei Amazon. Gehen Sie nicht in die Leihbücherei. Verschonen Sie das freundliche Personal Ihrer gut sortierten Buchhandlung mit drängenden Nachfragen. Ein Druckerzeugnis mit dem Titel „Das große Buch der Fernsehregeln“ existiert nicht. Sie sind überrascht? Sie waren sich sicher, dass die Kollegen in den Redaktionen alle nach dem gleichen Leitfaden arbeiten würden? Schließlich laufen die meisten Fernsehbeiträge doch nach einem auffallend ähnlichen Muster ab. Niemand hat das treffender karikiert als Guardian-Mann und BBC-Presenter Charlie Brooker (der allerdings keine Apple-Computer mag) in der Sendung „Newswipe“. Das hier muss sich eigentlich jeder anschauen, der auf irgendeine Weise mit der Produktion von TV-Nachrichten oder Magazinbeiträgen zu schaffen hat. Wer es dann gesehen und nicht mindestens drei Mal betreten zur Seite geblickt hat, ist kein echter Fernsehmensch und darf ab sofort nicht mehr mitspielen.
Wir sind also ertappt worden. Nicht unbedingt beim Schummeln, Tricksen oder Fälschen. Aber beim Verwenden allzu beliebter bildsprachlicher und dramaturgischer Schablonen. Solche standardisierten Gestaltungsmittel sind niemals ausdrücklich verabredet worden, sie stehen auch in keinem Lehrbuch, aber jeder benutzt sie, weil sie jeder benutzt. „Standard news report visual language“ heißt das bei Brooker.
Und so kommt mir eine Idee wieder in den Sinn, die ich mit dem Kollegen Heinemann schon des öfteren zu fortgeschrittener Stunde besprach, ohne dass wir je Gelegenheit hatten, sie in die Tat umzusetzen (worüber die eine oder andere Redaktion ganz sicher herzlich froh ist). Wir wollten immer mal den prototypischen Magazin-Beitrag drehen, der mit wenigen Textanpassungen nahezu jeden gewünschten Sachverhalt zu illustrieren vermag. Hier kommt zumindest ein Treatment dafür, nicht zufällig besonders für Gesundheitsmagazine geeignet.
Leise Klaviermusik in Moll. Gern auch Cello - je nachdem, was die Musikbibliothek bei den Suchbegriffen „traurig“ „niedergeschlagen/freudlos“ oder „sehnsüchtig“ so auswirft. Totale: Ein Mann geht einsam durch einen Park. Sollte kein Park verfügbar sein, tut es auch ein langer Krankenhausflur. Schnitt auf das Gesicht des Mannes: Er schaut sinnend in die Gegend. Der Sprecher berichtet ergriffen vom Schicksal des Protagonisten. Etwa so: „Jahrelang ahnte Herbert M. nichts von dem, was sich in seinem Körper abspielte. Die Infektion mit dem heimtückischen Erreger hatte er nicht bemerkt. Doch eines Tages im letzten Jahr wurde mit einem Schlag alles anders.“

Nun wird es höchste Zeit, das Schicksal des Protagonisten zu verallgemeinern. Was würde sich da besser eignen als die bekannten Bilder von Menschen in einer Fußgängerzone, selbstverständlich mit Telebrennweite aufgenommen. Falls sich ein fantasiebegabter Cutter findet, kann er diese Sequenzen in der Postproduktion noch mit einem netten, modischen Effekt versehen. Beliebt wären Slow Motion (alles läuft langsamer), Speed Motion (alles läuft schneller), Stroboskop (alles läuft ruckliger), Shutter-Effekte (alles läuft ruckliger und ist außerdem unscharf) oder Überblendungen von mehreren verschiedenen Einstellungen. Musik: irgendetwas unruhig Elektronisches. Kommentar: „Herbert M. ist kein Einzelfall. Immer mehr Deutsche infizieren sich jedes Jahr mit dem selben Erreger.“
Weiter geht es ganz nach Charlie Brookers Anleitung „How To Report The News“. Das Hintergrundbild von den marschierenden Fußgängern friert ein und tönt sich monochrom. Dann schieben sich drei oder vier Schriftzeilen herein, eine Liste von Fakten, für die keine passenden Bilder zu bekommen waren. Nehmen wir doch „Übergewicht“, „Bluthochdruck“, „Diabetes“ und „Herzrhythmusstörungen“. Passt immer.
Schnitt ins Praxiszimmer eines Arztes, der gleichzeitig einen medizinischen Berufsverband vertritt. Er ist derjenige, der die Übersicht hat. Oder dem diese Rolle zumindest zugeschrieben wird. Sein O-Ton geht etwa so: „Die betroffenen Patienten haben einen unerhörten Leidensdruck. Oft sind sie bereits durch eine regelrechte Therapiemühle gelaufen, bevor sie zu uns gekommen sind.“
Zurück zum Patienten. Dieser sitzt inzwischen entweder in seiner Küche und öffnet Briefe, oder er sinkt in die Wohnzimmercouch ein und schaut sich alte Fotos in einem Album an. Cellomusik wie am Anfang. Dazu der Off-Kommentar des Sprechers: „Herrn M.s Leben hat sich durch die Erkrankung völlig verändert.“ Das gleiche wird der Protagonist anschließend noch einmal im O-Ton sagen.
Nächste Sequenz - ein Labor. Da in modernen Labors die meisten Arbeitsschritte von Automaten vollführt werden, der Autor aber gern Menschen bei ihrer Tätigkeit zeigen will, lässt sich eine Laborantin seufzend dazu herab, für die Aufnahmen irgendeine Flüssigkeit von einem größeren Behälter in viele kleinere zu titrieren. Die Sprecherstimme erläutert dazu irgendetwas Unverständliches von Immunantworten, Antikörpern oder Nachweisreaktionen. Danach gibt es einen zweiten Auftritt unseres Arztes. Er mahnt: „Die Dunkelziffer der Infizierten ist hoch. Leider wollen die verdammten Krankenkassen eine flächendeckende Screening-Untersuchung der Gesamtbevölkerung nicht bezahlen. Das wird uns alle noch teuer zu stehen kommen.“
Der Beitrag endet wieder im Park mit dem porträtierten Patienten. Die Wahl der Schlusseinstellung entscheidet, in welcher Stimmung der Zuschauer zurück bleibt. Entfernt sich der Protagonist von der Kamera - wie ein Cowboy, der in den Sonnenuntergang reitet -, unterstreicht dies die Hoffnungslosigkeit des Falles. Geht er auf die Kamera zu, lässt sich zumindest ein Rest von Kampfeswillen erahnen. Sprechertext, ja nach Version: „Herbert M. gibt nicht auf/für Herbert M. ist eine Welt zusammengebrochen“. Charlie Brooker, übernehmen Sie.
Kamera, Megafon, Computer - so gewinnt man Preise.

