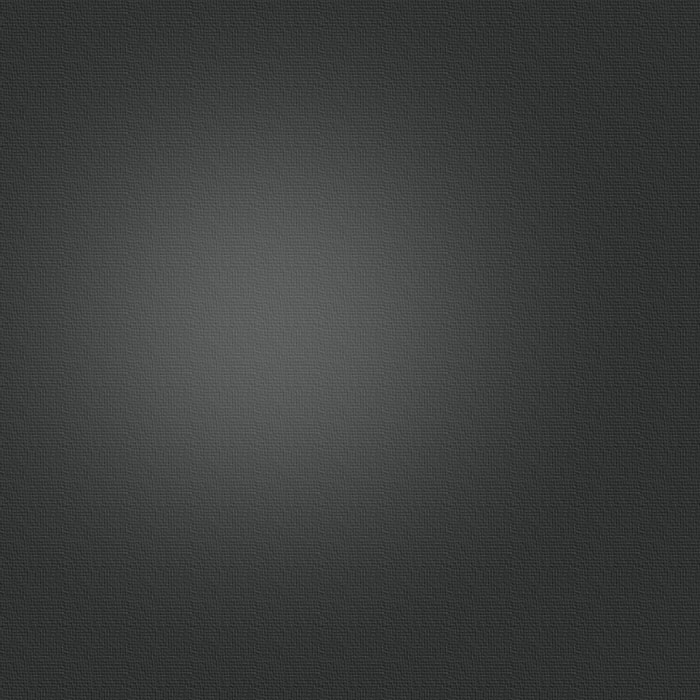Der englische Schriftsteller und Biograph
Izaak Walton (1593 bis 1683) lobte einst die Erdbeere über den grünen Klee. "Zweifellos hätte Gott eine bessere Beere als die Erdbeere erschaffen können, aber ebenso zweifellos hat er es nicht getan." Hat er aber doch, entgegne ich da forsch. Als wenn der liebe Gott nicht immer noch einen draufsetzen würde. Wer je eine wirklich vollreife Waldbrombeere
vor der Nase und dann auf der Zunge hatte, wer spüren durfte, welche Aromen da den Mund ausfüllen, der wird der Erdbeere ihre Krone womöglich wieder aberkennen.
Nur: Brombeeren, die auch nur eine Spur dieses einzigartigen Wildgeschmacks aufweisen, sind schlichtweg nicht handelsüblich. Während man im Falle der Erdbeere zumindest noch die winzige Chance hat, in einem gut geführten Hofladen einen Korb mit Früchten zu finden, die tatsächlich nach etwas schmecken, existiert diese Möglichkeit für Brombeeren praktisch nicht. Na gut, jedenfalls nicht in der Gegend, in der ich wohne.
Bei kaum einer anderen Frucht hatte die Kultivierung durch die Gärtner so verheerende Folgen. Es gelang, den wehrhaften Ranken die Stacheln wegzuzüchten, um die Beeren leichter ernten zu können. Dann ließ man die Früchte zu monströser Größe schwellen. Jetzt entsprechen sie wahrscheinlich irgend einer geheimen EU-Verordnung. In der gleichen Vorschrift
steht womöglich auch, dass der Verbraucher auf gar keinen Fall mit irgend einer Form von Eigengeschmack irritiert werden dürfe.
Es hilft nichts. Wer dem verlorenen Brombeeraroma nachjagen möchte, zieht sich am besten robuste Lederhosen und eine alte Leinenjacke an und stürzt sich selbst ins Rankendickicht. Man wappne sich zugleich mit männlichem Gleichmut gegen tiefe Hautrisse, Wespenattacken und, sofern man in sonnigen Teilen Brandenburgs sammelt, auch gegen eine Begegnung mit dem
Ammen-Dornfinger. Bei meinem letzten Brombeer-Ernteeinsatz lag überdies ein verwesender Igel neben den Sträuchern.
All die Fährnisse dürfen nicht zählen, wenn es um den schönsten Preis geht - die tiefschwarze, saftpralle, duftende Scheinbeere von
Rubus fruticosus.
Wohl dem, der einen Kleingarten weiß, an dessen Zaun die stachligen Ranken noch geduldet werden. Aus vielen Gärten sind Sorten wie „Theodor Reimers“ mittlerweile aber verschwunden, nur noch ihre stachellosen Schwippschwager sind übrig geblieben. Die klassischen Sandbrombeeren wurden an den Rand der Kolonien gedrängt, sind dort verwildert oder haben sich ins angrenzende Ödland vorgearbeitet.
In der Tat ist die Brombeere ein rechter Rumtreiber. Zusammen mit Kletten, Beifuß, Nesseln und immer häufiger dem Japanischen Knöterich fällt sie unter die
Ruderalpflanzen. Wo der Mensch sich zurückzieht, rückt die Brombeere nach, wehrhaft und genügsam. Sie nimmt Bahndämme in Besitz, überwuchert alte Rangieranlagen, dringt in verfallene Fabrikgebäude vor und annektiert verlassene Kasernenhöfe. Das verlangt eine gewisse Achtsamkeit bei der Wahl des Sammelgebiets. Abgedeckte Bauschuttdeponien mögen gerade noch angehen. In unmittelbarer Nachbarschaft von
Fernverkehrsstraßen jedoch, auf ehemaligen Produktionsstandorten für Fotochemikalien oder Napalm sowie auf verölten sowjetischen Militärflächen macht die Ernte keinen Spaß.
Ideal ist ein wilder Brombeerverhau mitten im Wald, fern von Nitrateintrag, Dieselruß und zeternden Kleingärtnern. Dann ist nur noch der exakte Zeitpunkt der Ernte von Belang. Zwischen Juli und September reifen die Beeren. Innerhalb von wenigen Tagen verwandeln sie sich von knackharten, sauren Bällen mit viel zu vielen Samenkernen in saftige Aroma-Wunderwerke. Auf dem Höhepunkt der Reife gibt es einen kurzen Moment, in dem sich der kräftige Oberton der Geschmackspartitur entwickelt. Eine fast animalische Note, bei der schon zu ahnen ist, dass die Beeren bald verderben werden. Mit der friedlichen Süße etwa einer Erdbeere hat das gar nichts mehr zu tun. Nur um diesen Moment geht es. Brombeeren reifen nicht nach, also ist die Hoffnung unbegründet, zu früh gepflückte Früchte würden das ersehnte Aroma schon noch bilden. Konservieren lässt sich dieser einzigartige Geschmacksmoment ebenfalls kaum. Frische, vollreife Brombeeren mit nur ein wenig

Zucker und Milch - das ist die Darreichungsform, in der die Früchte den tiefsten Eindruck hinterlassen. Schon das kurze Aufkochen bei der Marmeladenbereitung lässt das Aroma schwächer werden. Und doch kann man so zumindest eine Ahnung des Geschmacks für das kalte Halbjahr aufheben.
Heute kam ich mit fünf Kilogramm Brombeeren nach Hause zurück. Wahrscheinlich werde ich die nächsten Nächte davon träumen. Meine Unterarme sehen aus wie die eines Junkies. Und doch schwimme ich in Glückseligkeit - diese Augenblicke, in denen man zwei Rehen durchs Unterholz folgt und plötzlich vor einer wahren Wand
tiefschwarzer Beeren steht. Oder jener Moment, in dem sich aus dem hüfthohen Gras unversehens ein kleiner Hügel erhebt, komplett mit Brombeerranken bewachsen, die dicht an dicht Früchte tragen. So muss das sein.
Ergebnis der abendlichen Kocherei - 17 Gläser Konfitüre, davon drei, die jeweils einen knappen Liter fassen. Brombeeren bringen von selbst reichlich Pektin mit, sodass man den Zuckerzusatz knapp und die Kochzeit kurz halten kann. Anderthalb Kilogramm waren für die Königsdisziplin der Fruchtaufstrich-Bereitung reserviert - das Gelee. Eigentlich eine verschwenderische Technologie,

weil nicht, wie bei der Konfitüre, die ganze Frucht verarbeitet wird, sondern nur der Saft. Die möglichst nicht oder nur schnell gewaschenen Beeren werden dafür so erhitzt, dass sie platzen und der Saft komplett austritt. Die zerkochten Früchte kommen in ein Seihtuch, in dessen vier Ecken man Knoten schlägt. So kann man es zwischen die Beine eines umgedrehten Hockers hängen. Der Saft läuft über Nacht in eine Schüssel ab. Man muss der Versuchung widerstehen, mit den Händen nachzuhelfen - wer die Fruchtmasse drückt oder wringt, bekommt zähes, trübes Gelee und nicht die feine, zarte Konsistenz, nach der man sucht. Übrig bleibt ein Klumpen feuchter Fruchtmatsch, der schweren Herzens in die Biotonne gekippt wird. Vielleicht fällt mir bis zur nächsten Ernte ja noch eine Verwertungsmöglichkeit dafür ein. Den Saft mit (Gelier-)Zucker vermischen und nur eine Minute kochen. Endabrechnung: Anderthalb Kilo Rohware, daraus 700 ml Saft, mit Zucker ergab das 6 Gläser Gelee. Das dürfte für diesen Sommer genügen.