Quitten für die Menschen zwischen Emden und Zittau
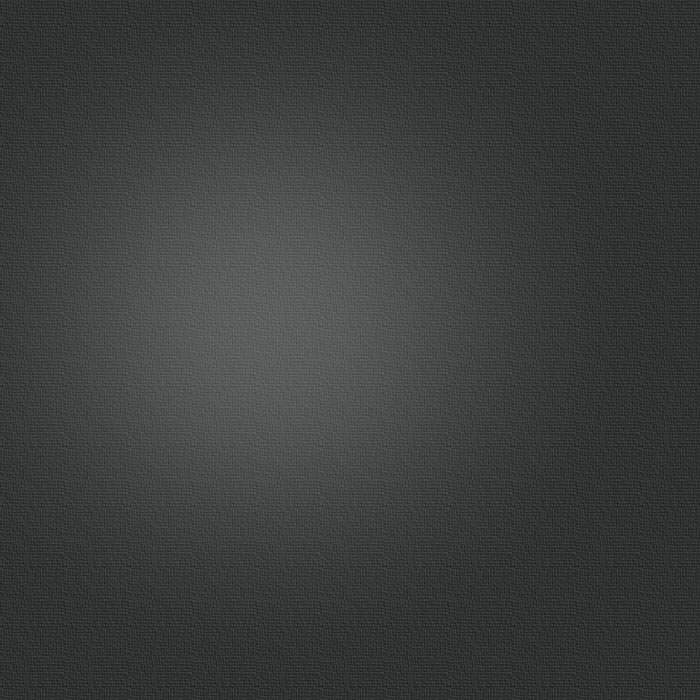

Samstag, 17. November 2007

Quitten sind ein Kernobst, dem der gemeine Konsument mit Reserviertheit begegnet. Die Früchte befremden mit einem in der Vollreife überaus durchdringenden Geruch, einem seltsamen bitteren Flaum auf der wachsartigen Schale und nicht zuletzt der ernüchternden Eigenart, dass sie ohne erheblichen Zubereitungsaufwand nicht zu genießen sind. Selbst Gartenbesitzer, auf deren Nutzfläche ein Quittenbaum steht, wissen mit dessen Ertrag gelegentlich nichts anzufangen und lassen das Obst lieber gleich hängen oder schnöde vom Ast fallen. Cydonia oblonga hat ein Vermittlungsproblem.
Der unvergleichliche Max Goldt hat vor einigen Jahren schon ins gleiche Horn gestoßen. „Quitten für die Menschen zwischen Emden und Zittau“ forderte er in seinem Kulturtagebuch, weil ihm aufgefallen war, dass Quitten, obschon dramatisch unbeliebt, über ein Aroma verfügen, das „einfach himmlisch, wenn nicht sphärisch“ sei.
Nur am Rande sei hier angemerkt, dass The Orb ein - erstaunlich schwaches - Album namens „Cydonia“ veröffentlich haben. Außerdem gibt es einen Song der Band Muse, der sich „Knights of Cydonia“ nennt (hier mehr). Es würden aber nur Böswillige diesen Titel mit „Ritter der Quitte“ übersetzen. „Cydonia“ bezieht sich in beiden Fällen wohl auf eine Marsregion, die diesen Namen trägt und ihn wiederum von der Bezeichnung eines untergegangenen altgriechischen Stadtstaates auf Kreta entlehnt haben dürfte.
Lange Zeit war die einzige mir bekannte Darreichungsform von Cydonia oblonga das Quittenbrot - Max Goldt verwendet dafür den Begriff „Quittenspeck“ - meiner Oma, das in Form kautschukzäher, überzuckerter Rauten in irgendwelchen Blechdosen überwinterte. Als Kind ist man zwar geneigt, alles mit neugierigem Wohlgefallen aufzunehmen, was den Anschein der Süßigkeit hat. Doch das hier ging mir zu weit. Ich erwartete harmloses Fruchtgelee und stieß auf überparfümierte Gummiblöcke. Das Kapitel Quitten war vorerst zu Ende.
Dann kam die Schule. Auf den Rabatten des Pausenhofs gedieh, was ostdeutsches Gärtnereiwesen offenbar als angemessen für die Bepflanzung solcher Örtlichkeiten ansah. Kniehohe Sträucher mit Scheinquitten. Deren Zweige trugen nicht nur Dornen, sondern auch steinharte, gelbgrüne Früchte. Handliche Wurfgeschosse, schon klar, aber der Geruch, den sie an den Fingern hinterließen, war widerlich. Der Begriff „Quitte“ gewann einen noch schlechteren Klang. Das war natürlich ungerecht, denn die Scheinquitte hat mit der echten Frucht botanisch nicht allzu viel zu tun. Der feine Sinn für solche Unterschiede fehlte mir allerdings seinerzeit.
Später begegnete ich der Quitte wieder. Wiederum nicht unter den besten Voraussetzungen. Gelee und Sirup aus Quittensaft wurden gern an jenen improvisierten Verkaufsständen angeboten, an denen wohlmeinende Ehrenamtliche zu Adventsbasaren Spenden für irgendeinen vorgeblich guten Zweck einwarben. Die gleichen Herrschaften, die auch Kuchen mit hohem Möhrenanteil für eine Delikatesse halten und Kürbisse mangels anderer Verwertungsideen zu Marmelade einkochen. Klingt alles ganz besonders, schmeckt nur keinem. Wer hier widerspricht, der möge innehalten, seinen Kühlschrank öffnen und nach dem Glas Kürbis-Möhren-Ingwer-Konfitüre schauen, das dort gewiss seit dem letztjährigen Christfest vor sich hingärt. So etwas wird nie mit der gleichen Begeisterung auf das Frühstücksbrötchen geschmiert werden wie ein manierliches Pflaumenmus.
Warum ich dann doch einen Weg zur Quitte fand, ist mir nicht vollständig erklärlich. Eventuell erlahmte mit zunehmendem Lebensalter einfach mein Widerstand. Andererseits halte ich mich an das Prinzip, jedem bisher zurückgewiesenen Nahrungsmittel alle paar Jahre mal eine Chance zu geben. Irgendwann war die Zeit reif für die Quitte und mich.
Seit letztem Jahr hat sich nun eine zuverlässige Quelle für die großen Gelben erschlossen. Eine liebe Kollegin bringt jeden Spätherbst einige Tüten davon in die Redaktion, woselbst sie bis zur Übergabe im Wintergarten verwahrt werden - andernfalls gäbe es vermutlich Beschwerden von Kollegen, die sich durch die allfälligen Duftschwaden belästigt fühlen. Diesen November fielen gleich zehn, zwölf Quitten für mich ab, was zu angestrengten Überlegungen Anlass gab, in welcher Form sich die Früchte wohl konservieren ließen. Für die Anfertigung jenes hervorragenden Quittenbrandes, den wir uns aus Österreich mitbringen konnten, fehlen mir leider die Kenntnisse und die technischen Voraussetzungen.

Das Quittenbrot-Verfahren wiederum ist ein Kapitel für sich. Und deswegen vertage ich das.
Quitte, Cydonia oblonga. Im Wettbewerb um das unbeliebteste Kernobst ganz vorn dabei. Auch die Ritter der Quitte können daran wenig ändern. Aber Max Goldt fordert, die Quitte in die Sparte des eigenständigen Genussmittels hineinzuemanzipieren.

